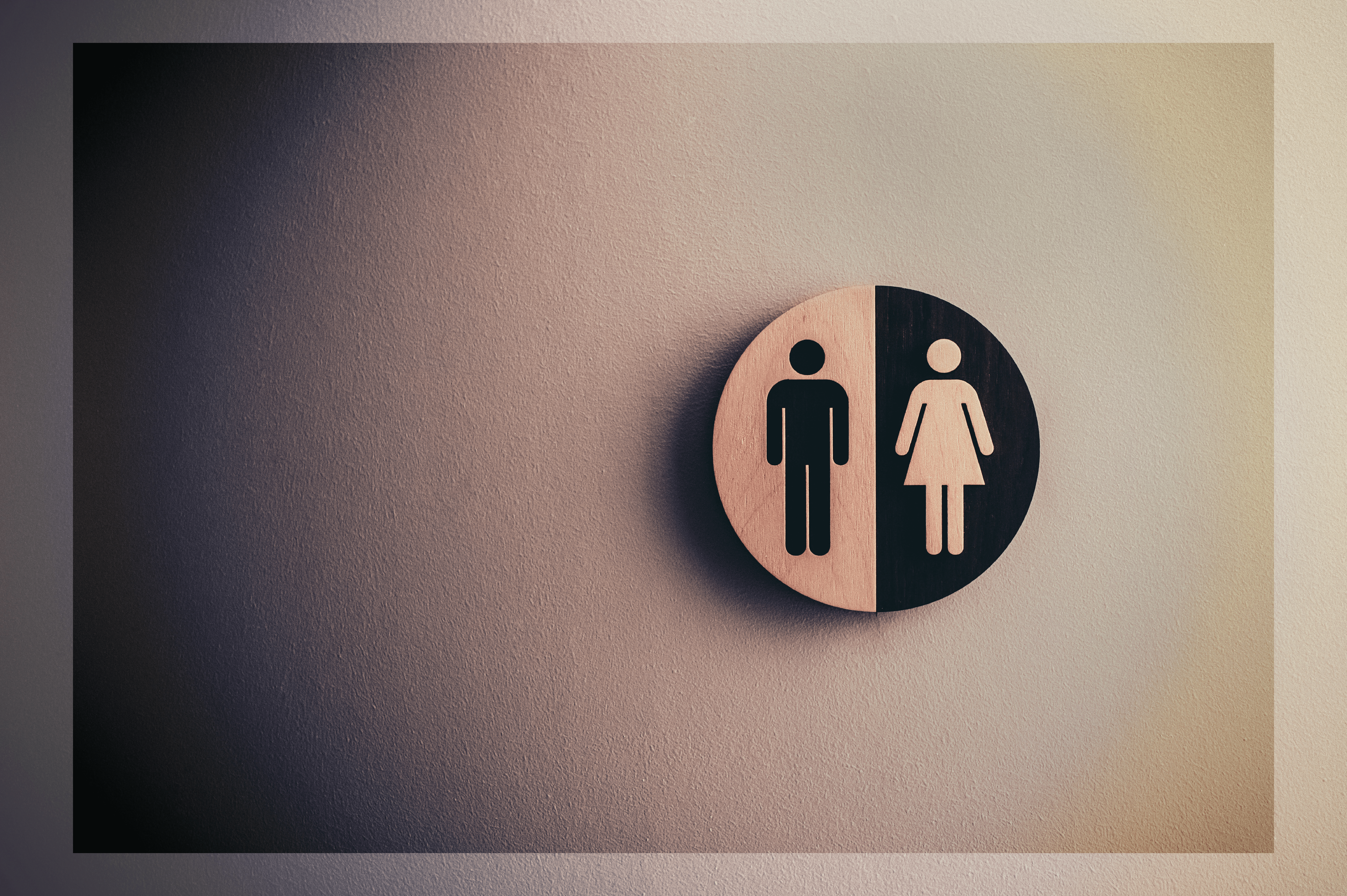Studierst Du im Lehramt und weißt nicht, ob Du „Schüler“, „Schülerinnen und Schüler“ oder einfach „SuS“ schreiben sollst? Du findest Gendern nervig und denkst, es stört den Lesefluss in Deinen Seminararbeiten? Dann erfährst Du hier gute Gründe fürs Gendern und warum Du statt „Schülerinnen und Schüler“ auch „Schulkinder“ schreiben kannst.
Früher oder später wirst Du Dich sowieso mit dem Gendern auseinandersetzen müssen. Heutzutage gilt es nicht mehr als guter wissenschaftlicher Standard, das generische Maskulin zu benutzen. Selbst der Hinweis zu Beginn einer Hausarbeit, dass Du mit dem generischen Maskulin alle Geschlechter miteinbeziehst, könnte mittlerweile zu Punktabzügen in Deiner Hausarbeit oder Abschlussarbeit führen.
Warum solltest Du überhaupt gendern?
Um das Gendern werden hitzige Debatten geführt. Leider gibt es genug Stimmen, die das generische Maskulin für ausreichend halten, weil es noch nie jemanden gestört hat. Ein schwaches Argument, wenn Du bedenkst, dass sich Sprache immer im Wandel befindet: Sie ist heute nicht wie früher und wird auch nie wieder wie heute sein. Deshalb zählt das Argument „es war schon immer so“ einfach nicht. Außerdem wird Gendern als lästig, radikal feministisch oder gar als übertriebene political correctness gesehen. Richtig Gendern ist aber keine Hipster Angelegenheit und bestimmt auch keine Modeerscheinung. Denn Sprache ist schließlich unser wertvollstes und wichtigstes Werkzeug zur Kommunikation. Warum also gleich rund 50% der Bevölkerung allein durch Sprache regelrecht ausschließen? Um diesen Punkt zu verdeutlichen, versuche dieses Rätsel zu lösen:
Ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto. Sie haben einen schweren Unfall, bei dem der Vater sofort stirbt. Der Sohn wird mit schweren Kopfverletzungen in eine Spezialklinik eingeflogen. Die Operation wird vorbereitet, alles ist fertig. Der Chef-Chirurg erscheint, wird plötzlich blass und sagt: „Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn!“
Wie kann das sein, wenn der Vater während des Unfalls gestorben ist? Die Antwort ist eigentlich denkbar einfach, denn es ist die Mutter des Kindes. Wenn du jetzt denkst: „Okay, dann hätte man aber Chirurgin gesagt“, liegst Du ziemlich sicher falsch. Wird in erster Linie vom Beruf gesprochen und nicht direkt von der Person, die diesen Beruf ausführt, wird in der Regel das generische Maskulin benutzt. Dafür kannst Du wenig, denn Du bist mit dieser Sprache aufgewachsen und hast auch nur das gelernt, was Dir beigebracht wurde. Umso wichtiger ist es, das eigene Handeln und Denken zu reflektieren, auch beim Thema Sprache.
An unsere Ausdrucksweise knüpfen sich etliche Norm- und Wertvorstellungen. Konkret bedeutet das, wenn wir das Wort „Arzt“ hören, denken wir unterbewusst an einen männlichen Arzt. Männlich konnotierte Begriffe wie Arzt stammen aus einer Zeit, in der Frauen nun mal keine Ärztinnen waren. Und dass Frauen Ärztinnen werden können, ist im Vergleich zur langen Geschichte der deutschen Sprache gar nicht so lange her.
Wie sieht es andersherum aus? Begriffe wie „Putzfrau“ wurden zum Beispiel selbstverständlich zu Putzkraft geändert, aber eine Feuerwehrfrau ist im Volksmund immer noch ein Feuerwehrmann, weil der Beruf „Feuerwehrmann“ männlich und „Putzfrau“ weiblich konnotiert ist. Deshalb hat es gendergerechte Sprache so schwer, denn dank Erziehung und Sozialisation haben uns diese Rollenbilder über viele Jahre geprägt. Überwinden lassen sich diese nur mit viel Arbeit und Disziplin.
Okay, aber wie gendere ich richtig?
Nun gilt es, die richtige Art des Genderns herauszufinden. Gender Gap (Stundent_in), Gendersternchen (Student*in) Binnen-I (StudentIn) oder Paarform (Studentinnen und Studenten)? In erster Linie ist das zunächst egal. Wichtig wäre einerseits, die gewählte Form in der gesamten Arbeit beizubehalten und nicht zwischen verschiedenen Formen zu wechseln. Weit verbreitet sind außerdem Partizipformen und geschlechtsneutrale Bezeichnungen, die du mit den eben genannten Formen gut kombinieren kannst, wie „Studierende“, „Angestellte“, „Seminarleitung“, „Lehrkräfte“ oder „Schulkinder“. Entscheidend ist, dass Du Dir das Benutzen von Sprache in Dein Bewusstsein rückst. Aller Anfang ist schwer! Eine hilfreiche Website ist übrigens das Genderwörterbuch https://geschicktgendern.de/ , das ständig erweitert wird. Hier kannst Du Inspiration für Formulierungen sammeln, solltest Du mal nicht weiter wissen.
Schwierig wird es erst, wenn Du mit Artikeln, Pronomen und Adjektiven konfrontiert wirst. Hier wirst Du definitiv am Häufigsten hängenbleiben und an Formulierungen feilen. Zwar musst Du auf grammatische Stimmigkeit von Nomen und Pronomen achten, gleichzeitig aber auch sprachlich unelegante oder sperrige Formulierungen vermeiden. „Jeder Student“ könnte sich somit in „Alle Studierende“, „Jede/r Studierende“, „Jede/r Studentin und Student“ usw. verwandeln. Auch das Wörtchen „man“ kann durch Passivsätze umgangen werden. Das solltest Du allerdings bereits wissen, denn „man“ hat in einer wissenschaftlichen Hausarbeit auch ohne das Genderthema eigentlich nichts zu suchen.
Richtig Gendern durch Uni Leitfaden
Viele Unis haben mittlerweile in ihren Internetauftritt aufgenommen, wie in Hausarbeiten, Emails oder ähnliches gegendert werden kann oder soll. Oft steht das in einem allgemeinen Leitfaden zum Schreiben wissenschaftlicher Hausarbeiten und kann von Institut zu Institut ganz unterschiedlich sein. Hier lohnt sich auf jeden Fall der Blick zu den Institutsseiten Deines Studiengangs oder auf den allgemeinen Seiten der Universität. Siehe hier zum Beispiel den Leitfaden der Uni Freiburg. Im Zweifel kannst Du immer bei Deinen Betreuerinnen und Betreuern nachfragen.
Keine Frage, gendergerechte Sprache umzusetzen verlangt Motivation und einen Haufen Arbeit. Du wirst auf viele sprachliche Probleme stoßen und hin und wieder verzweifeln. Doch der Aufwand ist es wert. So wie unsere Sprache im Wandel ist, gilt dies auch für unsere Gesellschaft. Und klar, gendergerechte Sprache schafft längst noch keine Gleichberechtigung. Allerdings darf Gleichberechtigung nicht Schritt für Schritt, sondern muss in vielen Bereichen gleichzeitig erfolgen. Gendergerechte Sprache setzt ein Zeichen gegen das unterbewusste Bild, dass der Mann als Norm für die gesamte Gesellschaft gesehen wird und Frauen „nur“ eine Abweichung davon sind.
Hast Du noch Fragen zum Thema Gendern oder noch weitere Tipps? Dann teile sie gerne mit uns.